Mit besserem Feedback zu mehr Gleichstellung bei der Arbeit
- Luka Özyürek

- 15. Juli 2025
- 5 Min. Lesezeit
Mit besserem Feedback zu mehr Gleichstellung bei der Arbeit
Vom kurzen “Gut geworden!” bis zum jährlichen Mitarbeitendengespräch, vom strukturierten Projekt-Debrief bis zum Post-it auf dem Kühlschrank, Feedback kann viele Formen annehmen und ist aus dem Arbeitsleben nicht wegzudenken. Aus gutem Grund, denn eine gute Feedbackkultur führt zu mehr Transparenz, deckt Fehler frühzeitig auf und schont dadurch Ressourcen, und trägt sogar zur Mitarbeitendenbindung und -motivation bei. Und: gutes Feedback ist für einen inklusiven, vielfältigen Arbeitsplatz unverzichtbar.
Gutes Feedback deckt Biases und Mikroaggressionen auf
Fangen wir mit dem Offensichtlichen an: Selbst wenn es in einem Unternehmen erstmal keine direkte Diskriminierung gibt, sind unbewusste Voreingenommenheiten und Mikroaggressionen doch an der Tagesordnung. Sie sind es, die gerade für marginalisierte Menschen auf lange Sicht das Arbeitsklima unangenehm machen. Wer möchte schon jeden Tag intime Fragen beantworten oder über den hundertsten Witz auf Kosten der eigenen Identität lachen müssen? Was, wenn mir auffällt, dass die Personalchefin seit Jahren nur weiße Menschen einstellt oder für die Konferenz doch wieder zu 90% männliche Speaker gebucht wurden?
Das zu thematisieren bringt oft eigene Probleme mit sich. Wer selbst betroffen ist, wird als zu empfindlich abgestempelt oder muss sich vorwerfen lassen, die “Race-Karte”, “Gender-Karte”, “Behinderungs-Karte” zu spielen. Wer kritisiert wird, reagiert schnell mit “War doch nicht so gemeint” oder “Aber ich habe doch gute Gründe!”
Und genau dort greift Feedback: Eine gesunde Feedbackkultur ermöglicht es, dass alle sich trauen, etwas zu sagen, alle gehört werden und Bedenken nicht beiseite gewischt werden können. So kann eine ernsthafte, wohlwollende Auseinandersetzung entstehen - lange bevor der hundertste “harmlose Kommentar” das Fass zum überlaufen bringt.
Was hat Feedback mit Macht zu tun?

Vielleicht etwas weniger offensichtlich, aber nicht weniger wichtig: Feedback kann Machtstrukturen aufbrechen - oder sie verfestigen. Wenn Feedback von Führungskräften nur gegeben wird, ihre Mitarbeitenden aber kein eigenes Feedback einbringen können, dann bleibt ihr Verhalten unhinterfragt, ihre Voreingenommenheiten bestimmen uneingeschränkt das Arbeitsklima und führen zu autoritären, intransparenten Strukturen. Das haben viele Unternehmen inzwischen erkannt und setzen auf bilaterales oder 360°-Feedback - doch die sind leider kein Allheilmittel gegen Machtgefälle.
Typischer Stolperstein Nummer Eins: Accountability. Mitarbeitende müssen Feedback umsetzen, sonst bekommen sie irgendwann Probleme. Führungskräfte hingegen können sich Feedback der Mitarbeitenden zu Herzen nehmen - oder eben auch nicht. Kaum ein Unternehmen setzt Konsequenzen für nicht umgesetztes Mitarbeitendenfeedback oder verlangt, dass transparent geteilt wird, warum Feedback nicht umgesetzt wird oder werden kann. Das führt bei Mitarbeitenden zu Frust und dem Gefühl, nicht ernst genommen zu werden - eine der häufigsten Beschwerden, die uns in Bezug auf Arbeitskultur begegnen.
Gesellschaftliche Machtstrukturen machen vor dem Büro nicht halt
Typischer Stolperstein Nummer Zwei: Unterschiedliche Perspektiven auf Hierarchien. Auch das beobachten wir regelmäßig. Die Führungskraft begreift sich als ein Mensch, zu dem man mit allen Anliegen kommen kann und der immer für Feedback offen ist. Die Mitarbeitenden wiederum trauen sich nicht, mit der Führungskraft zu sprechen, weil sie befürchten, anzuecken und sich schlimmstenfalls Chancen zu verbauen - denn egal wie nett sie ist, Macht hat eine Führungskraft eben immer.
Für marginalisierte Mitarbeitende gilt das doppelt, denn hier kommen zu dem Machtgefälle zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden auch noch gesellschaftliche (und häufig unbewusste) Machtstrukturen hinzu. Auch hier stellen sich die Fragen: Wer wird ernst genommen, wer hat zu verlieren, wer hält allein aus Prinzip zu wem? Kann die weibliche Kollegin bei anzüglichen Kommentaren auf Unterstützung durch den männlichen Vorgesetzten zählen? Versteht die heterosexuelle Geschäftsführerin, warum ein queerfeindlicher Kommentar nicht okay war? Rein statistisch muss man leider sagen: Eher nicht.
Natürlich beschränken sich diese Machtgefälle nicht nur auf Führungskräfte, sondern zeigen sich überall, wo es Probleme und Konflikte gibt. Der junge, körperlich fitte Kollege kann oft selbstbewusst kündigen, wenn er sich nicht mehr wohlfühlt, denn er wird verhältnismäßig leicht einen neuen Job finden - aber was ist mit dem älteren Kollegen mit Behinderung? Oder der Kollegin, deren Aufenthaltsstatus von ihrem Job abhängt? Wer kann gehen und wer muss ertragen? Wer kann es sich leisten, ehrlich zu feedbacken, und wer muss die Konsequenzen fürchten?
Gutes Feedback denkt unterschiedliche Kommunikationsstile mit
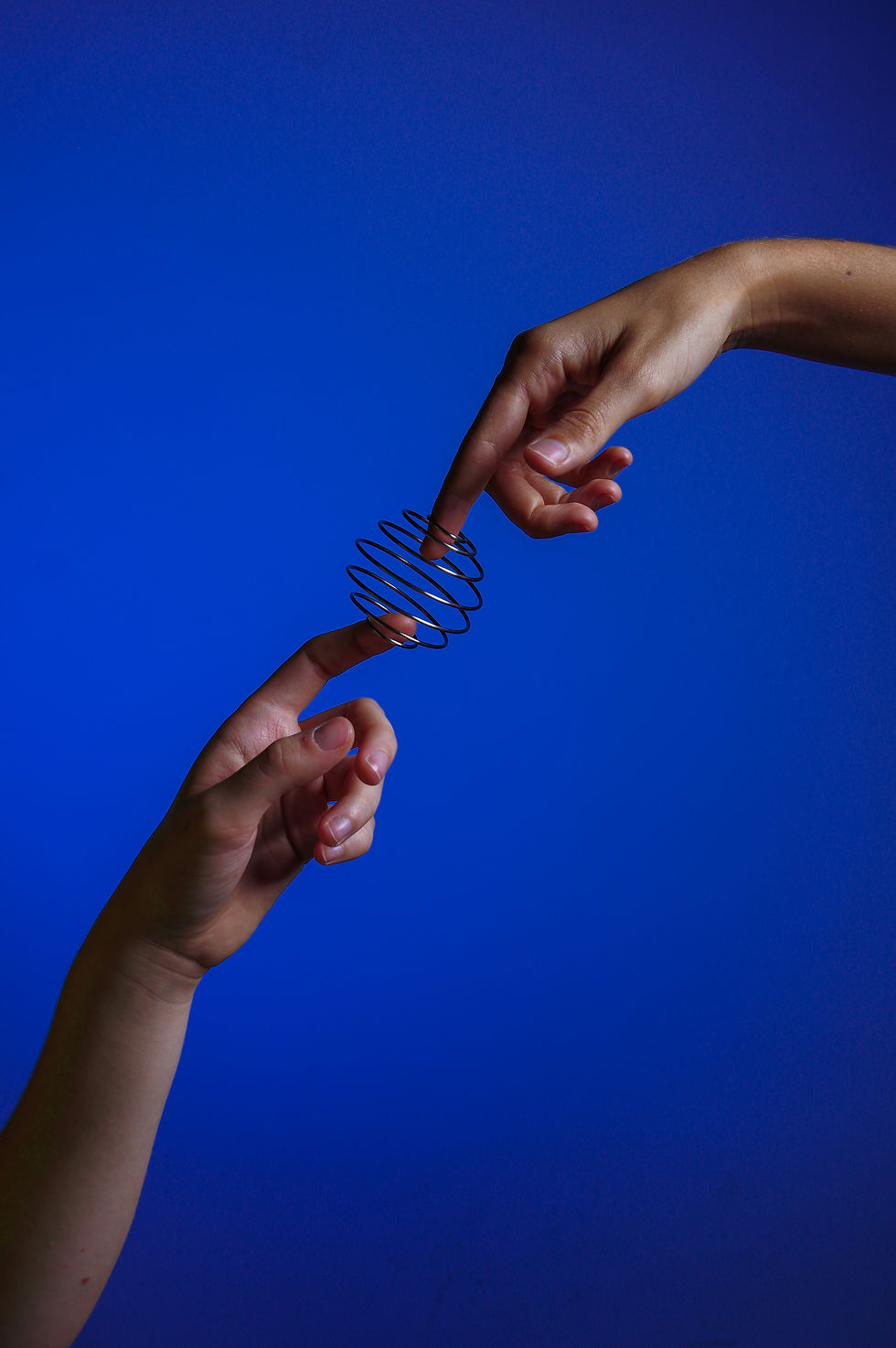
Ein weiterer Aspekt von Feedback und Inklusion sind unterschiedliche Bedürfnisse, was Kommunikation angeht. Sei es kulturell bedingt, im Zusammenhang mit Neurodivergenz oder einfach Persönlichkeitssache, nicht jede Art des Feedbacks funktioniert für jede Person. Während die einen gerne direkt heraus sagen, was ihnen auffällt, und in Nettigkeiten verpackte Wünsche nicht verstehen, ist ungeschminkte Kritik für andere ein absolutes No-Go. Den einen fällt es leichter, Feedback schriftlich zu geben, den anderen im persönlichen Gespräch. Für die einen ist ein einstündiges Feedbackgespräch die perfekte Möglichkeit, tief einzutauchen und neue Erkenntnisse zu gewinnen, die anderen fühlen sich davon erschlagen und haben am Ende die Hälfte schon wieder vergessen. Wer diese unterschiedlichen Kommunikationstypen nicht mitdenkt, verliert wertvolles Feedback und lässt Potenzial ungenutzt.
Gutes Feedback für mehr Gleichstellung bei der Arbeit
Zusammenfassend also: Ehrliches Feedback über Hierarchien hinweg ist die Grundlage für eine inklusive Arbeitskultur ohne versteckte Diskriminierung, in der alle Mitarbeitenden ihr volles Potenzial entfalten und einbringen können. Doch Feedback spiegelt auch Machtstrukturen: nicht jede*r kann ohne Sorgen die ehrliche Meinung sagen, während insbesondere Führungskräfte Feedback häufig ohne Konsequenzen ignorieren können. Gibt es keine offiziellen Feedbackstrukturen, werden nicht alle ihr Feedback ungefragt abgeben - sind die Strukturen wiederum zu einseitig, bleibt ein Teil der Mitarbeitenden auf der Strecke.
Was können Unternehmen nun tun, um die Feedbackkultur zu verbessern? Einiges, doch diese Veränderungen brauchen Zeit - je intransparenter und hierarchischer die bestehenden Strukturen und je weniger Vertrauen im Team herrscht, desto mehr. Eine gute Feedbackkultur etabliert sich nach und nach, wenn alle regelmäßig merken: Feedback ist erwünscht, wird ernst genommen und wertgeschätzt, auch und gerade von Führungskräften.
Damit das funktioniert, müssen alle lernen, gutes, inklusives Feedback zu geben und zu nehmen. Du kannst dich an diesen fünf Grundprinzipien orientieren.
Die fünf Grundprinzipien des inklusiven Feedbacks
Inklusives Feedback wird regelmäßig und zeitnah gegeben. Liegen die besprochenen Situationen zu weit zurück, ist es schwerer, sie sich wieder ins Gedächtnis zu rufen - und etwas ändern kann man oft auch nicht mehr. Denke dabei auch an das Follow-up für früheres Feedback. Hat sich etwas verändert? Gibt es noch Fragen?
Inklusives Feedback ist informiert, spezifisch und konstruktiv. Formuliere nicht nur konkret, was gut oder schlecht gelaufen ist und warum, sondern reflektiere auch, woher du deine Informationen beziehst (eigene Beobachtung, Hörensagen?), welche konkreten Learnings du siehst und welche Konsequenzen du dir wünscht.
Inklusives Feedback denkt Strukturen mit. Hinterfrage die Machtverhältnisse zwischen dir und der Person, der du feedbackst. Kann sie ehrlich mit dir sprechen, ohne Konsequenzen zu befürchten - und wenn ja, weiß sie das? Woher? Was könnte es euch erschweren, einander ehrliches Feedback zu geben? Versuche, soweit wie möglich auf Augenhöhe zu kommunizieren.
Inklusives Feedback achtet auf passende Zeit und Raum. Vermeide es, Feedback zwischen Tür und Angel oder vor dem ganzen Team zu geben, sondern warte einen ruhigen Moment ab. Je komplexer das Feedback, desto mehr Zeit solltest du einplanen, damit alle Beteiligten sich in Ruhe äußern können.
Inklusives Feedback denkt unterschiedliche Bedürfnisse mit. Frage dein Team, deine Vorgesetzten oder Kolleg*innen, was sie brauchen, um Feedback gut geben, annehmen und umsetzen zu können. Versuche, diese Bedürfnisse soweit wie möglich zu berücksichtigen.
Welche Feedbackmethoden kannst du nutzen?
Um diese Prinzipien in die Praxis umzusetzen, reicht schon ein einfaches, unstrukturiertes Gespräch aus - und das kleine “Gut gemacht!” nebenbei darf ausführliches Feedback natürlich trotzdem ergänzen. Es kann aber auch hilfreich sein, konkrete Feedbackmethoden zu nutzen, um Gespräche zu strukturieren, den Prozess zu standardisieren und Gleichstellung bei der Arbeit zu fördern. Nächste Woche stellen wir dir deshalb unsere Lieblings-Feedbackmethoden vor. Schau doch mal rein!



